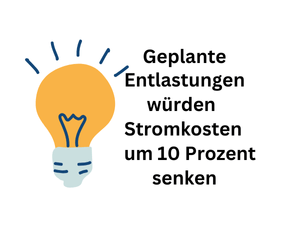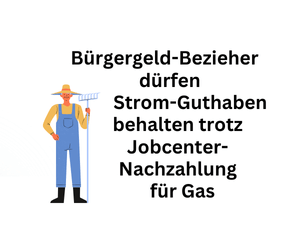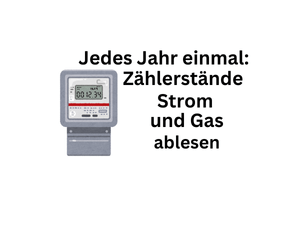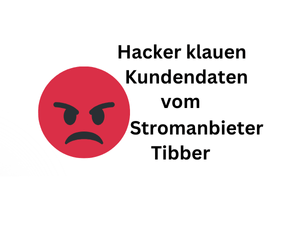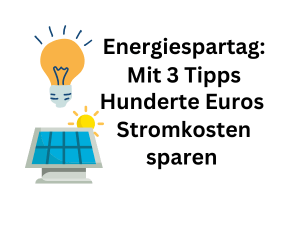Kernfusion: Wann könnte der erste Reaktor Strom bereistellen?
Inhaltsverzeichnis [Ausblenden]
Prinzipiell geht es bei der Kernfusion darum, Atomkerne zu verschmelzen. Das unterscheidet die Kernfusion von althergebrachten Atomkraftwerken, die mit Kernspaltung tätig sind.
Bei der Fusion von Tritium und Deuterium, zwei außergewöhnliche Ausprägungen des Gases Wasserstoff, entwickeln sich Neutronen und das Edelgas Helium.
Erstere bringen die Energie hervor. Die Methode gilt als sauber, unproblematisch und dürfte in grenzenloesem Umfang Strom* erzeugen – folglich eine Art Wunderwaffe in diesem Sektor.
Wie geht das?
In der Sonne finden derartige Fusionsvorgänge statt, weil das Zentralgestirn über eine außergewöhnlich große Masse verfügt. Auf der Erde sind weitere Vorgehensweisen erforderlich.
In der Hauptsache stehen hierbei 2 im Fokus: Der Fusionsvorgang kann auf der einen Seite in einem über 100 Millionen Grad heißen Plasma angefeuert werden, das von Magneten in der Schwebe gehalten wird.
Auf der anderen Seite kann Materie im Ausmaß eines Pfefferkorns mit einem extrem punktgenauen Laser befeuert werden, die Energie des Strahls kurbelt die Fusion an.
Wie kann dadurch Strom produziert werden?
Strom zu produzieren, ist allem Anschein nach das Problemloseste bei der Kernfusion. Die Neutronen werden etwa kurz gesagt von einer Wand festgehalten, die sich erhitzt.
Aufgrund der Hitze verdunstet Wasser, das eine Turbine vorwärtstreibt, die abermals Strom produziert. In ähnlicher Weiese läuft das auch in Atom-, Gas und Kohlekraftwerken.
Woran arbeiten die Spezialisten?
Auf der ganzen Welt haben Spezialisten vorrangig durchleuchtet, wie sich Fusionen in einem Plasma verwenden lassen, das in einem Magnetfeld hängt.
Mit der Laserfusion befasse sich hauptsächlich die Armee. Maßgebend in Deutschland sind das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München und das Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen.
Das IPP unterhält 2 Geräte, die Plasma herstellen: Wendelstein X-7 in Greifswald und Asdex in Garching. Beide grenzen sich in der Ausprägung gegeneinander ab. Bei Asdex haben die Magnetspulen eine herkömmliche Donut-Ausprägung (Tokamak), bei Wendelstein X-7 ist der Magnetkäfig in sich verrenkt (Stellarator).
Wo steht Deutschland?
Die Bundesrepublik zählt zu den Ländern, die bei Kernfusionsforschung die Nase vorn hat. Beim Stellarator ist Deutschland bereits beherrschend. Was international ausbleibt, ist bislang die ökonomische Verwendung.
Darum kümmern sich verstärkt Privatunternehmen, die bis Mitte 2024 auf der ganzen Welt 7,1 Milliarden Dollar von Kapitalanlegern einsammelten, wie die Unternehmensberatung Arthur D. Little ermittelt hat.
Diese Thematik wollen in Deutschland 4 Start-ups beschleunigen: Proxima Fusion (München) und Gauss Fusion (Garching) bevorzugen die Stellarator-Technologie.
Focused Energy (Darmstadt) und Marvel Fusion (München) bevorzugen Laser-Fusion, verstärkt werden sie außerdem von der Bundesagentur für Sprunginnovation Sprind. Auf der ganzen Welt existieren 47 Fusionsunternehmen.
Wann dürfte der erste Reaktor Strom bereitstellen?
Ein witziger Spruch lautet seit Jahrzehnten: Der Erfolg ist stets 30 Jahre in der Ferne. Unter Umständen dauert es aber nicht so lange. Proxima Fusion will zu Beginn der 2030er Jahre einen Demonstrator erstellen, eine verkleinerte Testausführung eines Kraftwerks, die praktisch beweist, dass Kernfusion technologisch machbar ist und Strom bereitstellen kann.
Gauss Fusion tüftelt ebenfalls an einem Stellarator. Trotzdem wird aller Voraussicht nach ein US-Unternehmen als Erstes durch die Ziellinie laufen: Commonwealth Fusion Systems, eine Ausgründung des Massachussetts Institute of Technology, will 2027 einen Demonstrator gebaut haben. Das Start-up hat hierzu über 2 Milliarden Dollar bei Kapitalanlegern einkassiert.
Gemäß dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW gibt es zusammengenommen gegenwärtig fast 169 Projekte in verschiedenen Ausbaustufen. Sollte ein Demonstrator in Betrieb sein, erwarten Spezilaisten eine Bauzeit von wenigstens 10 Jahren für ein funktionsfähigess Fusionskraftwerk, demnach dann frühestens 2040.
Wieso braucht das alles so viel Zeit?
Die Anlagen brauchen ein bestimmtes Ausmaß. Wendelstein X-7 hat einen Durchmesser von fast 11 m. Die Magnetspulen für derartige Geräte sind mächtig, beim Stellarator müssen sie aufgrund der Verrenkung separat erstellt werden.
Supraleitendes Material lässt stärkere Magnetfelder zu als Kupferspulen. Es muss jedoch auf minus 270 Grad abgekühlt werden.
Bislang ist vieles davon nur reine Theorie. Bei einem Laserfusionsexperiment in den USA gelang es 2022 zum ersten Mal, mehr Energie zu produzieren, als an Heizenergie hineingetan wurde.
„Aus Betrachung der Energiewirtschaft ist die Kernfusion momentan von einer geschäftlichen Verwendung ebenso so weit weg wie in den 1950er Jahren, als die Enstehung für nicht militärische Aufgaben anfing“, erklärt Christian von Hirschhausen, Wirtschaftsprofessor der Technischen Universität Berlin, der die Thematik für das DIW aufgeabrbeitet hat.
(Mit Angaben www.morgenpost.de/wirtschaft/05.04.2025)